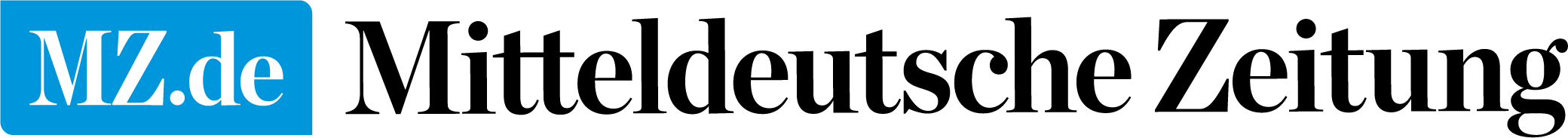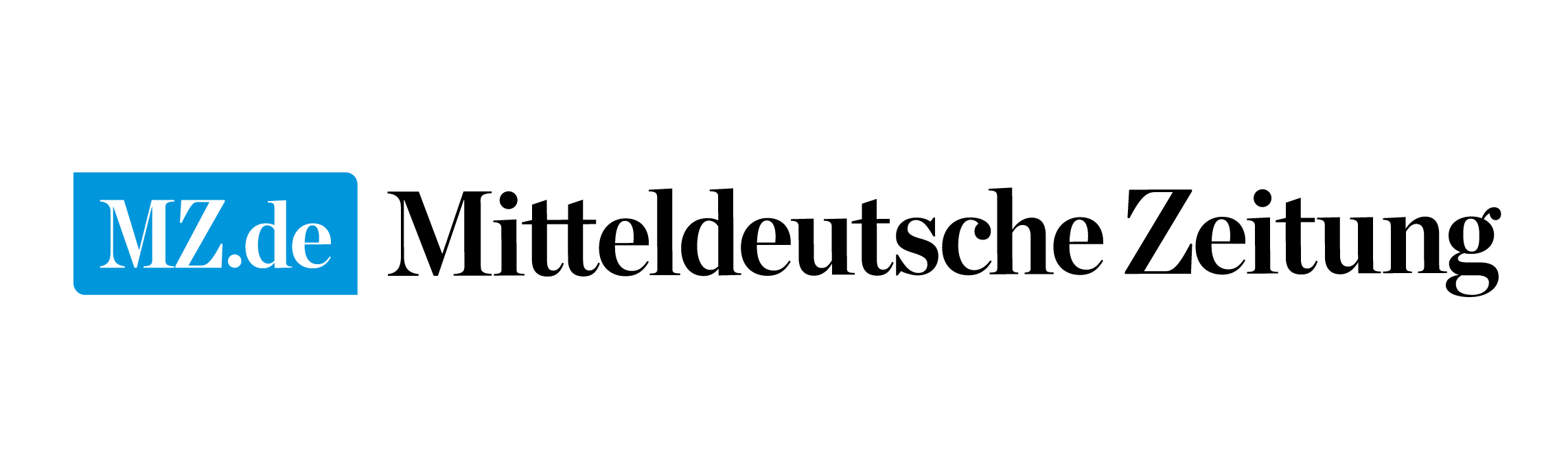Flucht in ein neues Leben
Seit Kriegsbeginn haben knapp fünf Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Heimat verlassen und in europäischen Ländern Schutz gesucht. Tausende sind auch nach Sachsen-Anhalt gekommen. Zwei betroffene Familien erzählen von ihrer Geschichte.

Krieg vernichtet Träume. Er reißt Menschen aus ihrem sozialen Kontext, zerschneidet Biografien in ein Davor und Danach. Seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 haben knapp fünf Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Heimat verlassen und in europäischen Ländern Schutz gesucht.
Es ist die größte Fluchtbewegung, die Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt hat. Seit Beginn des russischen Angriffs im Februar 2022 wurden in europäischen Ländern knapp fünf Millionen geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer registriert, vor allem in den umliegenden Nachbarstaaten. Das größte Aufnahmeland ist Polen.
Auch Deutschland ist eines der wichtigsten Aufnahmeländer. Seit Februar 2022 wurden rund eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer in der Bundesrepublik registriert.
In Sachsen-Anhalt leben aktuell rund 29.000 Geflüchtete aus der Ukraine. Große Ballungszentren sind Magdeburg und Halle.
Zehn Tage nach Kriegsbeginn hat die Europäische Union Anfang März verkündet, dass alle Menschen, die vor der russischen Gewalt Schutz suchen, in ihren Mitgliedsländern willkommen seien. Sie mussten kein Asylverfahren durchlaufen, konnten sich ohne Visum in der EU bewegen und sofort Arbeit aufnehmen.
In Deutschland werden ukrainische Geflüchtete wie anerkannte Asylbewerber behandelt. So haben sie Anspruch auf Grundsicherung und Zugang zum Gesundheitssystem, außerdem wird ihnen dadurch der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert. Die Kosten dafür übernimmt überwiegend der Bund. Bei der Verteilung der Geflüchteten in Deutschland wird der sogenannte Königsteiner Schlüssel angewendet. Auf Basis der Steuereinnahmen und der Bevölkerungszahl legt er fest, zu welchem Anteil die einzelnen Bundesländer Geflüchtete aufnehmen müssen. Das betrifft aber nur Geflüchtete, die keinen ersten Anlaufpunkt, etwa bei Verwandten, in Deutschland haben.
Wer flieht, sucht sich sein Zielland vor allem danach aus, ob dort Freunde, Verwandte oder Bekannte leben, die bei den ersten Schritten in der unbekannten Welt helfen können. In einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zur Lebenssituation von ukrainischen Geflüchteten gaben 60 Prozent der Befragten dieses Motiv als maßgebend für die Wahl Deutschlands an.
So sind Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer auch nach Sachsen-Anhalt gekommen. Aber welche Schicksale stecken hinter den Zahlen? MZ-Redakteur David Fuhrmann hat mit zwei betroffenen Familien gesprochen, die in Sachsen-Anhalt Zuflucht gefunden haben. Es sind Ukrainerinnen und Ukrainer, die eine Geschichte von Flucht - mit all ihren Verlusten und Unwägbarkeiten - erlebt haben. So etwa Anhelina, die talentierte Violinistin:
Jetzt muss es schnell gehen. Sehr schnell. Sie haben gerade noch Tickets für einen Bus ergattert, der sie weg von der russischen Gewalt bringt, über die Grenze nach Polen, da, wo sie die Raketen nicht finden können. Zügig wird das Nötigste, das Liebste für die Flucht in das fremde Land zusammengerafft. Aber was nimmt man mit, wenn unklar ist, wie lange man fernbleiben wird? Wenn nicht einmal sicher ist, ob man jemals wieder in die Heimat zurückkehren kann?
Bohodar Khimiak, 18, packt seine Posaune ein, Schwester Anhelina, 16, die Violine und der jüngste Vasyl, 15, die Klarinette. Die Instrumente, das waren von klein auf ihre Heiligtümer, mit ihnen wuchsen sie in Kolomea auf, einer Kleinstadt im Westen der Ukraine. Vater Lubomyr war es, der die Instrumente einst für seine Kinder ausgewählt hatte.
Wenige Tage nach Kriegsausbruch stehen die drei Kinder mit ihrem Vater und Mutter Oksana, 46, am heillos überfüllten Busbahnhof von Kolomea. Wer kann, flieht. Vor den russischen Raketen, den Panzern und der Zerstörung, die sie bringen. Es steigen Frauen und Kinder in die Busse. Keine Männer. Unter Tränen verabschieden sich Kinder von ihren Vätern, Frauen küssen ihren Ehemann ein letztes Mal. Auch für Bohodar, Anhelina und Vasyl bedeutet die Flucht vorm Krieg den Abschied vom Vater, und für Oksana vom Ehemann. Zwar ist Lubomyr mit seinen 54 Jahren zu alt, um kämpfen zu müssen, er fühlt sich aber jung genug, um das Militär zu unterstützen. Als Leiter einer Bigband will er Geld für den ukrainischen Abwehrkampf erspielen. Ehe die Familie in den Bus steigt, umarmen sie Lubomyr - es sind Momente, die Oksana nicht mehr vergessen wird:
Wenige Tage zuvor, am 24. Februar 2022, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine losbricht, sind Bohodar und Anhelina nicht im Familienhaus in Kolomea, sondern an der Musikhochschule in Odessa. Denn die Geschwister sind talentiert, so sehr, dass sie mit zwölf ihre Heimatstadt verließen, um in der Stadt am Schwarzen Meer professionell an ihrem Instrument ausgebildet zu werden.
Am Tag des Kriegsbeginns hören sie das ferne Donnern der Explosionen in der Stadt, sehen am Horizont Rauch. Sie kennen den Krieg nicht, der Krieg war nur ein kurzes Kapitel im Geschichtsbuch. „In Odessa war es noch viel gefährlicher für sie, wir wollten, dass sie nach Hause kommen“, sagt Oksana.
Über den alten Dächern der Hafenstadt schwebt eine Wolke der Angst. Viele fürchten russische Kriegsschiffe, die im Hafen landen. Die Raketen abfeuern. „Es war besorgniserregend, dass die Kinder noch da waren, wir baten Bekannte, sie abzuholen und zu uns zu bringen.“ Elf Autostunden dauert der Weg von Odessa bis nach Kolomea – normalerweise. Am ersten Kriegstag ist ganz Odessa aufgeschreckt, viele suchen den Fluchtweg über die Autobahn. Auf der Strecke sind die Straßen fast überall verstopft, für Bohodar und Anhelina beginnt eine gefährliche Heimfahrt, auf der Bohodar erstmals die russischen Raketen sehen wird:
Ein Jahr später, es ist März, steht die Familie Khimiak vor dem zweistöckigen Gebäude, das für sie zu einem Stück Heimat geworden ist. Das Haus in Halle-Nietleben ist versteckt in einer schmalen Gasse, aber fällt sofort auf. Die Fassade ist bunt bemalt. Von links nach rechts erstreckt sich eine groß aufgetragene Klaviertastatur. Es sind Notenschlüssel zu sehen, der gelockte Kopf von Georg Friedrich Händel und verschiedene Instrumente. In der Tür des Gebäudes, der Musikschule Coda, stehen Erika und Taras Pobidinski, mit einer herzlichen Umarmung begrüßen sie Oksana, Bohodar, Anhelina und Vasyl.
Anfang der 2000er sind die Pobidinskis nach Deutschland gekommen, als ukrainische Spätaussiedler, wie Taras sagt. Über die Jahre verwirklichten sie ihren Traum von der eigenen Musikschule. Es war eine Investition in ihre Leidenschaft.
Im ersten Stock ist das Herzstück der Musikschule, ein großer Raum mit zahlreichen Instrumenten, Sofas und Lautsprechern. Anhelina und Vasyl sitzen versunken in Sitzsäcken und wischen durch ihre Smartphones. Leise spricht Bohodar vom Start in Deutschland, dass er noch keine Freunde gefunden habe, erzählt von seiner neuen Aufgabe als Lehrer in der Musikschule der Pobidinskis. „Ich möchte sowohl ukrainischen als auch deutschen Kindern dabei helfen, Musik zu erlernen“, sagt er. Bohodar wirkt sehr reif für sein Alter, er spricht wohlbedacht, er ist höflich. Bohodar hat große Ziele, er will auf den berühmten Bühnen der Welt auftreten. Seine Mutter Oksana hört ihm zu, wirkt stolz. Die Musik ist für die Familie Ablenkung und Schmerzmittel zugleich. „Die Musik hilft gegen den Schmerz, wenn ich spiele, kann ich alles um mich herum vergessen."

Oksana Khimiak, Taras Pobidinski, Anhelina Khimiak, Bohodar Khimiak, Vasyl Khimiak und Erika Pobidinski (von links nach rechts) vor der Musikschule Coda in Halle-Nietleben.
Oksana Khimiak, Taras Pobidinski, Anhelina Khimiak, Bohodar Khimiak, Vasyl Khimiak und Erika Pobidinski (von links nach rechts) vor der Musikschule Coda in Halle-Nietleben.
Oksana erinnert sich an den Tag, als die Familie die Heimatstadt, den Vater und Ehemann zurücklassen musste. „Im Bus gingen uns viele Gedanken durch den Kopf: Wie wird alles, wo kommen wir hin?“, sagt Oksana. In Warschau stiegen sie in den Zug nach Deutschland. „Am Bahnhof in Berlin wurden wir von Freiwilligen empfangen, die uns sehr geholfen haben“, sagt Oksana, „sie versorgten uns mit Essen und halfen uns beim Umsteigen in den nächsten Zug, der uns nach Bitterfeld brachte.“ Insgesamt habe die Reise 30 Stunden gedauert, völlig entkräftet verbrachten sie die erste Nacht in einer Unterkunft in Bitterfeld.
Durch Zufall erfuhr Taras Pobidinski, dass die Familie Khimiak in Deutschland war, er kannte Lubomyr aus gemeinsamen Zeiten an der Musikhochschule in Kiew. „Wir haben ihnen dann eine Wohnung in Halle besorgt und ihnen geholfen, hier anzukommen“, sagt Taras Pobidinski. Nach Ausbruch des Kriegs gründete er mit seiner Frau Erika den Verein „Ukraine Hilfe“. In den Räumen der kleinen Musikschule sammeln sie Hilfsgüter und koordinieren den Weitertransport in die Ukraine. Zweimal ist Taras selbst mitgefahren, verteilte an der ukrainischen Grenze Pakete mit Bettwäsche, warmen Decken, Winterkleidung, Medikamenten und Generatoren. In Halle auf dem Marktplatz organisierten die Pobidinskis ein Benefizkonzert, für Bohodar, Anhelina und Vasyl war es das erste Konzert in Deutschland.
Inzwischen leben Oksana und die Kinder ein knappes Jahr in Halle, Anhelina und Vasyl gehen auf ein Musik-Gymnasium. Wirklich heimisch fühlen sie sich noch nicht, die Verständigung mit den Mitschülern sei schwer. „Ich vermisse meine Freunde aus der Ukraine und vor allem meinen Vater“, sagt Anhelina. Zu Lubomyr haben sie täglich Kontakt, sie schicken sich gegenseitig Bilder, erzählen ihm vom Alltag in Deutschland. Ihr altes Leben leben sie auch über das Smartphone weiter, es hilft ihnen, den Kontakt zu den in ganz Europa verstreuten Freunden aus der Ukraine zu halten.
Anhelina und Vasyl versuchen, sich in der neuen Realität zurechtzufinden, auch mit der vertrauten Musik. Die Blicke gehen aber immer in Richtung Heimat, sie verfolgen den Krieg, denn der Kriegsverlauf bedingt ihre Wünsche und Träume für die Zukunft, wie Anhelina und Vasyl erzählen:
Krieg reißt Menschen aus ihrem sozialen Zusammenhang. Viele Geflüchtete haben Probleme, im neuen Land Freunde zu finden und richtig anzukommen. Sprache und Traumata gehören oftmals zu den Barrieren, bringen Geflüchtete dazu, sich zurückzuziehen. Für die Khimiaks ist die Musik ein Anknüpfungspunkt in Deutschland, ein Weg, sich auszudrücken. Für Oleh Konovalenko ist es der Boxsport:
Wenn die Angst wiederkehrt

Oleh Konovalenko, 48, ist kein Mensch, der vor seiner Angst wegrennt. Er hat gelernt, sie zu überwinden. Wer immer wieder in den Boxring steigt und weiß, Runde für Runde und Schlag für Schlag, Schmerzen aushalten zu müssen, der darf keine Angst haben. „Als Kind hatte ich viele Ängste, mit dem Boxsport habe ich sie bekämpft, sie besiegt, ich dachte, ich hätte keine Ängste mehr.“ Dieses Gefühl trug Konovalenko, damit wuchs er in der Ukraine auf.
Erst, als er das Dröhnen der Sirenen hört, das Licht der Explosion sieht, kommt die Angst zurück. "Ich wurde wach, war in meinem Zimmer, als ich plötzlich ganz in der Nähe eine große Explosion hörte, alles war hell, ich dachte, ein nuklearer Krieg hätte begonnen", sagt Konovalenko. In Kiew, am Morgen danach, am 26. Februar vor einem Jahr, verhallen die Sirenen nicht mehr. Konovalenko schafft es nicht mehr, seine Angst zu überwinden. Er beschließt, mit seiner Frau und den vier gemeinsamen Kindern zu fliehen, die kleine Wohnung im neunten Stock zurückzulassen. „Meine große Angst war, dass die Russen die Atomwaffen zum Einsatz bringen, wir mussten gehen.“ Das Leben verpackt im Kofferraum des Autos, fahren sie zunächst zu Verwandten in die westukrainische Stadt Lwiw. Über Bekannte seines Bruders stellen die Konovalenkos einen Kontakt nach Deutschland her, das Ziel ist jetzt ein neues: Stendal.

Der Weg zum Boxclub führt durch eine stille Straße, die wie ausgestorben im Grau des Nachmittags daliegt, vorbei an leerstehenden Gebäuden mit eingeschlagenen Fenstern, die sich am südlichen Stadtrand Stendals aufreihen. Zeugnisse einer schrumpfenden Stadt sind.
Nicht weit von hier baut das Land Sachsen-Anhalt eine ehemalige NVA-Kaserne zur Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber um. Bis zu 1.000 Menschen sollen in den beiden Gebäudeblocks ab 2025 Platz finden. In der Stadt teilen sich die Meinungen darüber. Manche begrüßen den Zuwachs, manche verstehen nicht, wie auf einmal Geld dafür aufgebracht werden könne. Andere fürchten steigende Kriminalität.
Auch im Boxclub herrscht Uneinigkeit. „Es ist wichtig, dass sich die neuen Menschen integrieren und ihnen Perspektiven aufgezeigt werden“, sagt Christoph Schlender, Trainer und Vorsitzender des Boxvereins Altmark Stendal. Es ist ein Montag, 17 Uhr, Schlender und Oleh Konovalenko sitzen in der kleinen Trainerkabine der maroden Turnhalle. Durch das Fenster ist zu beobachten, wie der Nachwuchs trainiert. Wie sich Kinder aus unterschiedlichen Nationen im Kreis des Holzparketts aufwärmen. Betritt ein neue Person die Halle, ist eine der ersten Fragen, ob sie Deutsch spreche. Der Boxverein ist ein Integrationsmotor in Stendal, die Leidenschaft bringt alle zusammen.

In der Kabine hockt Konovalenko nach vorne gebeugt auf einem kleinen Stuhl, die schwarzen Boxhandschuhe, die treuen Gefährten, liegen auf dem Schoß. Er erzählt von seinen vier Kindern, in Stendal seien sie ständig in ihren Handys vertieft, verlassen kaum das Haus. Es macht ihn wütend, er kann das nicht verstehen. „In der Ukraine haben sie Klavier geübt und Sport gemacht, sie waren aktiv“, sagt er. Seine beiden Töchter seien in Kiew an der Musikschule gewesen, die älteste habe in der Stadtmannschaft Basketball gespielt. Sein Sohn im berühmten Klub „Spartak“ als Judoringer trainiert. „Jetzt schauen sie den ganzen Tag nur noch in das blöde Gerät“, sagt er, seine Augen wirken traurig und müde.
Sein Lebensmittelpunkt ist jetzt der Boxclub geworden, „hier kann ich mich mit anderen Boxern unterhalten“, sagt Konovalenko. Dreimal die Woche trainiert er den Nachwuchs. „Viele ukrainische Kinder sind im Boxclub, ich kann ihnen beibringen, wie man sich verteidigt und wie man angreift. So fühle ich mich nützlich“, sagt er.
In Kiew arbeitete Konovalenko als Sportlehrer, einen bezahlten Job habe er in Stendal noch nicht gefunden. „Ich würde hier gerne als Massagetherapeut arbeiten und anderen Menschen helfen, wieder gesund zu werden." Solange er nichts in Aussicht hat, ist seine Woche von den Trainingszeiten im Boxclub bestimmt. Schlender, der auch Vorsitzender des Boxclubs ist, macht sich Sorgen um Konovalenko. Seit seiner Ankunft habe der Ukrainer deutlich abgenommen. Manchmal, so sagt Schlender, sieht er Konovalenko in der Stadt auf dem Fahrrad. Wie er umherfahre. Ziellos.